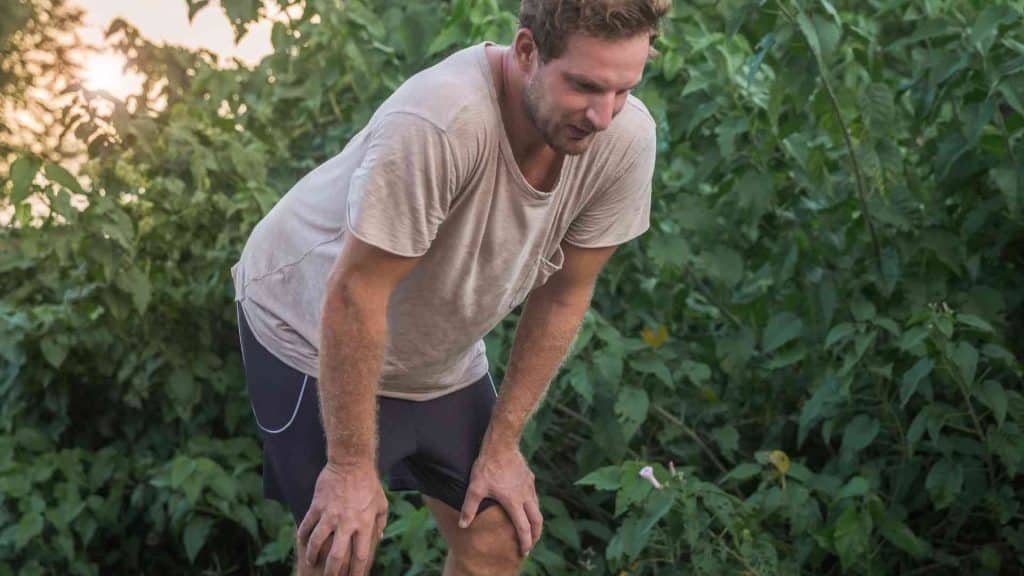Helfen Atemkontrollübungen bei einer obstruktiven Lungenerkrankung? Das war die Frage einer neuen Studie. Oder reicht ein normales Rehabilitationsprogramm? Untersucht wurde dies im Rahmen einer Rehabilitationsgruppe bei Patienten mit einer schweren obstruktiven Lungenerkrankung nach einer akuten Verschlechterung der Symptome.
Inhaltsübersicht (aufklappen)

Was ist COLD?
Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) ist eine chronisch entzündliche Lungenerkrankung. Sie schwächt den gesamten Organismus. Sie führt zu einer Behinderung des Luftstroms in den Luftwegen (Bronchien) der Lunge. Diese kann sich nicht mehr zurück bilden und ist damit irreversible. Bei der Verschlimmerung handelt es sich um eine mindestens zweitägige Verschlechterung (Exazerbation) der Symptome.
Die Symtptome bei COLD
Die Symptome bei COLD sind unterschiedlich stark ausgeprägt:
Atemnot / Dyspnoe
Bei körperlicher Belastung, später schon einfacher Betätigung und letztendlich bei geringer Anstrengung kommt es zu Atemnot.
Vermeidung von Leistung
Diese Leistungseinschränkung spüren PatientInnen im Gegensatz zu anderen Lungenerkrankungen (Fibrose) deutlich. Aus diesem Grund wird die Abforderung von Leistung semi-bewusst vermieden. Die Vermeidungshaltung führt zur Abnahme der Skelettmuskulatur und anderer Leistungsparameter. Das erschwert die Leistungserbringung zusätzlich und erhöht den Sauerstoffbedarf. Das führt neben der Grunderkrankung zu einer weiteren Dekonditionierung. Bei sehr geringem Leistungsvermögen wird eine sitzende Schonhaltung eingenommen.
Leistungsvermeidung führt zur sozialen Isolation
Neben der umfassenden Dekonditionierung in allen motorischen Bereichen und der Leistungsvermeidung kommt es zunehmend zu einer sozialen Isolation. Sie hat starke negativen psychologischen Folgen und fördert ihrerseits das Fortschreiten der Leistungsmeidung und somit auch das Voranschreiten der Einschränkung. Die Aktivitäten des täglichen Lebens (Activity of daily life ADL) nehmen immer mehr ab. So ist die Sitzaktivität um den Faktor 1,4 erhöht{Cavalheri, V.; Straker, L.; Gucciardi, D.F.; Gardiner, P.A.; Hill, K. Changing physical activity and sedentary behaviour in people with COPD. Respirology 2016, 21, 419–426}{Schneider, L.P.; Furlanetto, K.C.; Rodrigues, A.; Lopes, J.R.; Hernandes, N.A.; Pitta, F. Sedentary Behaviour and Physical Inactivity in Patients with Chronic 0Obstructive Pulmonary Disease: Two Sides of the Same Coin? COPD 2018, 15, 432–438}.
Weniger Leistung und soziale Isolation mindern die Lebensqualtität
Die Dyspnoe, die Leistungsminderung, die Aktivitätseinschränkung und die soziale Isolation beeinträchtigen die Lebensqualität von PatientInnen mit COPD. Entgegen der früheren Zielsetzung Verbesserung der Lungenfunktion ist mittlerweile eindeutig der Verbesserung der Lebensqualität im Fokus der Therapie. Die pulmonale Rehabilitation ist somit ein interdisziplinärer Vorgang. Sie umfasst neben der Linderung von Dyspnoe
- Soziale Teilhabe und Verbesserung der Lebensqualität
- Verbesserung der ADL auf multiple Weise (nicht nur motorisch) unter anderem mit:
- Sauerstofftherapie zielgerichtet und nur bei Notwendigkeit
- Energieverbrauch und Leistungsvermögen abzugleichen
- Kurzatmigkeit verringern und Atemkompetenz erhöhen
- Stärkung der Selbstwirksamkeit zur Bewältigung der Krankheit
Weitere Symptome
- Schleimbildung
- chronischer Husten
- Gefühl der Enge in der Brust
- Leistungsminderung
- Einschränkungen der Lebensqualität

Hilft Atemkontrolle?
In einem Sonderheft „Physiotherapie und kardiothorakale Versorgung in der akuten und chronischen Versorgung“ der Zeitschrift Healthcare erschien eine Studie über die Atemkontrollübungen in einer Gruppeneinstellung für PatientInnen mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung{Sibylle Cazorla, Yves Busegnies, Pierre D’Ans, Marielle Héritier, William Poncin. Breathing Control Exercises Delivered in a Group Setting for Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Randomized Controlled Trial. Healthcare 2023, 11(6), 877}. Es handelt sich dabei um eine randomisierte kontrollierte Studie*.
*Die Personen wurden also zufällig in die verschiedenen Gruppen gewählt (randomisiert). Ohne kontrollierte Designs mit Zufallszuweisung von PatientInnen lassen sich keine verlässlichen Aussagen zur Wirksamkeit von Maßnahmen machen. Dabei ist es wichtig, den kausalen Zusammenhang deutlich zu machen, also das Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung.
Bekannt ist, dass Lungenrehabilitationsprogramme zur Verbesserung bei COPD wirksam sind. Ziel dieser Studie war es, die Wichtigkeit von Atemkontrollübungen zu beurteilen. Zudem sollte der Effekt des Übens in einer Gruppe aufgezeigt werden. Damit sollte der Aspekt der Sozialisation mit anderen Personen in der Gruppe optimiert werden.

Die Studie
Teilnehmer
Von 40 ausgewählten nahmen 37 PatientInnen an der Studie teil. Das Alter war durchschnittlich 69 Jahren. Die Altersspanne betrug +/- sieben Jahre. Die Teilnehmer hatten eine COPD im Stadium III oder IV*. Zustand nach akuter Verschlechterung (Exarzerbation).
*Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)
Die demografischen Daten und Charakteristika zu Studienbeginn unterschieden sich zu Studienbeginn nicht signifikant zwischen den beiden Gruppen, mit Ausnahme der Prävalenz von Osteoporose.
Ausschlusskriterien
- Komplikation: Herz/Orthopädisch
- Rauchen
- Sprachbarrieren
- Bekannte kognitiven Beeinträchtigungen
Ort
Das spezielle Zentrum für COLD am J. Bracops Krankenhaus in Brüssel, Belgien.
Dauer und Vergleich
Die Dauer der Studie betrug sechs Wochen. Es wurde verglichen, ob zusätzliche Sitzungen mit Atemkontrollübungen einen signifikanten Effekt haben. Es handelte sich um konkret 20 Gruppensitzungen mit 30-minütigen Atemkontrollübungen.
Standardprogramm für beide Gruppen
Ausdauer
Das tägliche Ausdauertraining sind 30 Minuten kontinuierlichem Gehen auf einem Laufband oder Radfahren auf einem Fahrradergometer. Die Intensität beträgt 4 bis 6 auf der modifizierten Borg-Skala (subjektive Leistungseinschätzung), mit maximaler Anstrengung bei 10.
Kraft
Das Krafttraining sind 30 Minuten Widerstandsübungen an Geräten für Muskelgruppen der oberen und unteren Extremitäten. Jede Muskelgruppe absolviert 3 Sätze mit 10 Wiederholungen. Die Intensität beträgt 4 bis 6 auf der modifizierten Borg-Skala (subjektive Leistungseinschätzung), mit maximaler Anstrengung bei 10.
Alltag und Gebrauch
Die therapeutische Patientenaufklärung ist individuell. Folgende Aspekte werden berücksichtigt:
- Theorie:
- Anatomie der Lunge
- Pathophysiologie der COPD
- Anwendung verschriebener Inhalationsmedikamente
- Praxis:
- Umgang mit der Leistunsanforderung, Faktionieren der Leistungsabgabe, Einsatz der dosierten Lippenbremse, sparsame/ergonomische Haltung:
- Gehen (5 Mal pro Woche, 15 Minuten pro Sitzung) inklusive
- Schnürsenkel binden durch Hochlegen der Füße auf dem Stuhl
- Lastenausgleich in einer Einkaufstasche
- Treppensteigen (2 Mal pro Woche, 30 Minuten pro Sitzung)
- Gehen (5 Mal pro Woche, 15 Minuten pro Sitzung) inklusive
- Umgang mit der Leistunsanforderung, Faktionieren der Leistungsabgabe, Einsatz der dosierten Lippenbremse, sparsame/ergonomische Haltung:
- Zusätzlich
- 2 Sitzungen Toilettengang (20 Minuten pro Sitzung)
- Erste Woche
- Bewertung Autonomie und Unabhängigkeit des Patienten
- Ratschläge zur Fraktionierung der Anstrengungen
- Vorschläge für technische Hilfsmittel für die Toilettentätigkeit
- Dritten Woche
- Überprüfung und Anpassung
- Erste Woche
- 2 Sitzungen Toilettengang (20 Minuten pro Sitzung)
Zusatzprogramm Atemkontrollübungen
Zusätzlich in der Gruppen mit den Atemkontrollübungen wurden 3–4 Sitzungen pro Woche Atemübungen durchgeführt. Die Gruppe erhielt 20 Sitzungen pro Programm mit Atemkontrollübungen in einer Gruppenumgebung. Die Gruppengröße betrug 5–6 Teilnehmer und die Dauer pro Sitzung betrug 30 Minuten.
Basis der Übungen
Die Basis der Übungen waren die typischen Alltags- und Gebrauchsbewegungen der PatientInnen. Aus diesen wurden Kinetikübungen (Bewegungsübungen) für den Ober- oder Unterkörper mit offener Kette entwickelt. Eine solche Bewegung liegt vor, wenn das Endglied der Extremität frei beweglich ist. Diese Übungen trainieren gezielt Muskeln oder Muskelgruppen. Der Transfer Sitz zum Stand wurde nicht geübt.
Gezielter Einsatz von Hilfsmitteln
Die Bewegungen wurden individuell verstärkt durch den Einsatz von freien Gewichten durch Hanteln, Bälle und andere Hilfsmittel. Die Gewichtsbelastung richtete sich der zehnfachen, bequem durchführbaren Wiederholungszahl.
Atmung mit Bewegung
Die Kinetikübungen wurden mit dem gezieltem Einsatz von Atemkontrollübungen verbunden. Bei den jeweils 15 Sätzen mit je 10 Wiederholungen wurde bewusst die Einatmung oder die Ausatmung verbunden. Die Erholungszeit zwischen den Sätzen betrug 10 Sekunden.
Hintergrund
Die Atemvertiefung verlangsamt die Frequenz, stimuliert das autonome Atemmuster und vertieft den Rhythmus. Die motorischen Übungen verbessert insbesondere die Kraft und die Ausdauer. Eine Verlangsamung der Bewegung auf die Atemfrequenz erhöht das Bewegungsbewusstsein in den einzelnen Bewegungsphasen, wie zum Beispiel in der konzentrische Phase (Zusammenziehen) Einatmung (Inspiration) und in exzentrische Phase (Nachlassen) Ausatmung (Exspiration). Zudem wird die Anpassung an die Anstrengung angepasst.

Die Studienergebnisse
Primär wurde die Lebensqualität untersucht. Die Gesundheit von Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen ist krankheitsbedingt eingeschränkt. Dies wurde mit dem „Saint George’s Respiratory Questionnaire“überprüft. Das ist ein Standartverfahren zur Messung der Lebensqualität bei PatientInnen mit COLD. Er misst die allgemeine Gesundheit, das tägliche Leben und das wahrgenommene Wohlbefinden und unterteilt in drei Bereichen: Symptome, Aktivitäten und Auswirkungen.
| Rehabilitationsgruppe | Atemkontrollgruppe | |
| Lebensqualität | Keine Verbesserung | Der SGRQ-Score verringerte sich von durchschnittlich 60,4 (Spannbreite 43,6–71,8) auf durchschnittlich 43,2 (35,0–56,7), p < 0,001). Das bedeutet eine Verbesserung. Das Ergebnis ist signifikant (Signifikanzwert war sehr hoch p<0,001). |
Sekundär wurden verschiedene weitere Aspekte gemessen. Die subjektive Auswirkungen auf die Atmung wurde durch den COPD Assessment Test (CAT) erfasst. Es handelt es sich um einen standardisierten Fragebogen, mit dem das Ausmaß und die Häufigkeit der Symptome von PatientInnen mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) erfasst wird. Mit dem Test kann auch eine einfache Bestimmung des Schweregrades der Lungenerkrankung erfolgen.
| Rehabilitationsgruppe | Atemkontrollgruppe | |
| Häufigkeit der Symptome | Keine Verbesserung | Der CAT-Score verringerte sich von einem Mittelwert von 25,0 (Spannbreite 14,0–27,5) auf 15,0 (2,0–21,0). Das bedeutet eine Verbesserung. Das Ergebniss war signifikant (Signifikanzwert war sehr hoch p < 0,001). |
| Rehabilitationsgruppe | Atemkontrollgruppe | |
| Fünf mahlige Aufstehtest | Keine Verbesserung | Die 5STST-Zeit nahm ab von einem Mittelwert von 15,4 (Spannbreite 12,0–19,0) auf 12 (10,7–14,9). Das ist eine Verbesserung. Das Ergebnis war signifikant (Signifikantswert war sehr hoch p < 0,001). |
Borg-Skala (modifiziert) dient der Ermittlung der subjektiven Leistungempfindung.
| Rehabilitationsgruppe | Atemkontrollgruppe | |
| Borg nach Fünf mahligem Aufstehtest | Keine Verbesserung | Die Borg Einstufung nahm ab von einem Mittelwert von 8 (Spannbreite 7–8) auf 5 (3–6). Das ist eine Verbesserung. Das Ergebnis war signifikant (Signifikantswert war sehr hoch p < 0,001). |
Handgriff-Stärketest: Periphere Kraftermittlung durch den Jamar®-Handdynamometer
| Rehabilitationsgruppe | Atemkontrollgruppe | |
| Handgriff-Stärketest | Keine Verbesserung | Die HG Stärke stieg an von einem Mittelwert von 23,5 (Spannbreite 20,5–26,8) auf 25 (23,5–30). Das ist eine Verbesserung. Das Ergebnis war signifikant (Signifikantswert war sehr hoch p < 0,001). |
Fazit
Die Gruppe mit den Atemübungen in einer Gruppe erreichten deutliche Vorteile
- Lebensqualität
- funktionelle Kapazität
- Muskelkraft.
Übungen zur Atemkontrolle, die in einer Gruppe durchgeführt werden, sind für PatientInnen mit einer COLD zielführend. Das zeigt diese Studie.
Mechanismen für die Verbesserung in der Atemkontrollgruppe
Nicht alle Parameter lassen sich faktisch messen. Deshalb ist es wichtig, die Mechanismen für die Veränderung zu verstehen. Das geschieht durch Annahmen, wenn entsprechende Messparamater nicht voliegen:
Dyspnoewahrnehmung
Die Wahrnehmung der eigenen Luftnot ist ein sehr wichtiger Faktor. Die Verbesserung in der Atemkontrollgruppe erklärt sich aus der Zunahme der Muskelkraft, der verbesserten Kontrolle des Atemmusters und der erhöhten Toleranz gegenüber körperlicher Anstrengung. Das senkt den Atembedarf für eine bestimmte Anstrengung auf der einen Seite und erhöht das Lungenvolumen auf der anderen Seite. So können PatientInnen zum Beispiel Treppen steigen mit geringerer Dyspnoe ohne mehr Zeit zu brauchen, teilweise sogar weniger.
Sekundäre Wahrnehmung
Die Belastungstoleranz wird deutlich erhöht, bei gleichzeitig mehr gefühlter Muskelkraft. Das steigert die Lebensqualität, reduziert wiederum Dyspnoe und letztendlich die Müdigkeit.
Atemkontrollübungen in einer Gruppenumgebung führen zu einer funktionellen Verbesserung im Gegensatz zu einer allgemeinen Rehabilitation.
Grundgedanken für ein Programm
Ein allgemeines Rehabilitationsprogramm ist nicht zielführend. Es ist nicht angepasst an die individuellen Problemstellungen bei einer chronischen obstruktiven Lungenerkrankung. Für PatientInnen ist das Üben von Alltags- und Gebrauchssituation unter besonderer Kontrolle der Atmung hilfreich. Folgende Aspekte erscheinen wichtig:
- Die therapeutische Patientenaufklärung über das Krankheitsbild
- Was sind obstruktive Luftwegeveränderungen
- Wie kann man bei einer solchen Veränderung die Atmung unterstützen
- Die Wichtigkeit, die Bewegung und Atmung zu kombinieren.
- Vermittlung von Energiespartechniken
- Vermeidung von Pressatmung.
- Anpassung des Lebensumfelds unter anderem mit Hilfsmitteln und notwendigen Hilfen.
Die Anpassung ist individuell. Die allgemeinen Empfehlungen für spezielle Alltags- und Gebrauchsbewegungen können bei der spezifischen Genese nicht schematisch vermittelt werden. Dies ist auch ein Faktor, damit die Verhaltensänderung in den Alltag integriert werden. Diese Umsetzung ist essenziell.
Hinweis: Patienten mit COPD können jedoch aufgrund von Wissens- und Fähigkeitsdefiziten in ihrem Prozess der Verhaltensänderung mit erheblichen Hindernissen konfrontiert sein. Diese können eine Änderung des Lebensstils stark behindern. Die Therapie muss das unbedingt berücksichtigen.
Gruppensettings sind im Gegensatz zu Einzelsitzungen als günstig anzusehen. Der therapeutische Prozess wird durch die Gruppendynamik, Interaktion, soziale Kompetenz und Solidarität gestützt. Sekundär wird zudem die soziale Isolation gemindert.

Klinische Erfahrungen
In der Arbeitsgemeinschaft Atemtherapie des Zentralverbandes Physiotherapie (ZVK) und auch im klinischen Einsatz haben wir Atemkontrollübungen genutzt. Darüber hinaus wurden schon in den 90er Jahren entscheidende Vertiefungen der Therapiemethodik, gegenüber der dargestellten, erreicht. Die Studie unterstreicht deutlich diesen Ansatz, in dem sie die Wirksamkeit der gezielten Atemkontrolle zeigt.
Individuelles Übungsprogramm
Der Einsatz einer Atemskala neben der Borg-Anstrengungsskala hilft bei Belastungsfaktoren einzeln zu erfassen und in ein Verhältnis zu setzen.
Die Erfassung der Atembelastung sowie der allgemeinen Anstrengung wird ergänzt durch individuelle periphere Anstrengungsgefühle, zum Beispiel in den Unterschenkeln. Treten andere Befindungsbeeinträchtigungen, wie zum Beispiel Schmerzen, auf, dann werden diese mit erfasst. Die individuellen subjektiven Empfindungen werden mit den messbaren objektiven Befunden abgeglichen und ein gezieltes Übungsprogramm erstellt.
Atemübung+Atemerfahrung+Atemübung+…=Atembewusstsein
Die Atemübungen für eine PatientIn mit einer COLD berrücktsichtigen das individuelle Vermögen in besonderer Weise, also nicht nur bezüglich der Anstrengung. Dieses individuelle Lehr-Lernprogramm beginnt in einfacher Weise und nimmt die PatientIn auf eine Erfahrungsreise mit. Die Zielsetzung ist, ein Bewusstsein für die Atmung zu erhalten. Dieses neue Bewusstsein oder neue Gefühl ergänzt die bisherigen meist negativen um neue positive Erfahrungen. Die neue „Erlebnisse“ werden dann, wiederum durch gezielte und individuelle Lehr-Lernschritte in die Alltags– und Gebrauchsbewegungen integriert.
Entkopplung der Atmung
Die Atemübungen haben dabei nicht das Ziel einer Erhöhung der Kontrolle, welche im negativen Erfahrungsbereich ja ohnehin vorhanden ist. Sie dürfen idealerweise einen neuen Freiraum schaffen. Dazu werden die Atemübungen geschachtelt aufgebaut, mit dem Ziel das Atemzentrum mit einem neuen Programm zu ergänzen.
Die in der Studie angestrebte Atemkopplung an die konzentrischen und exzentrischen Bewegungen werden dabei in Folge gezielt entkoppelt. Dies beginnt mit Bewegungen einzelner Muskelgruppen und entwickelt sich zu Ganzkörperbewegungsmustern.