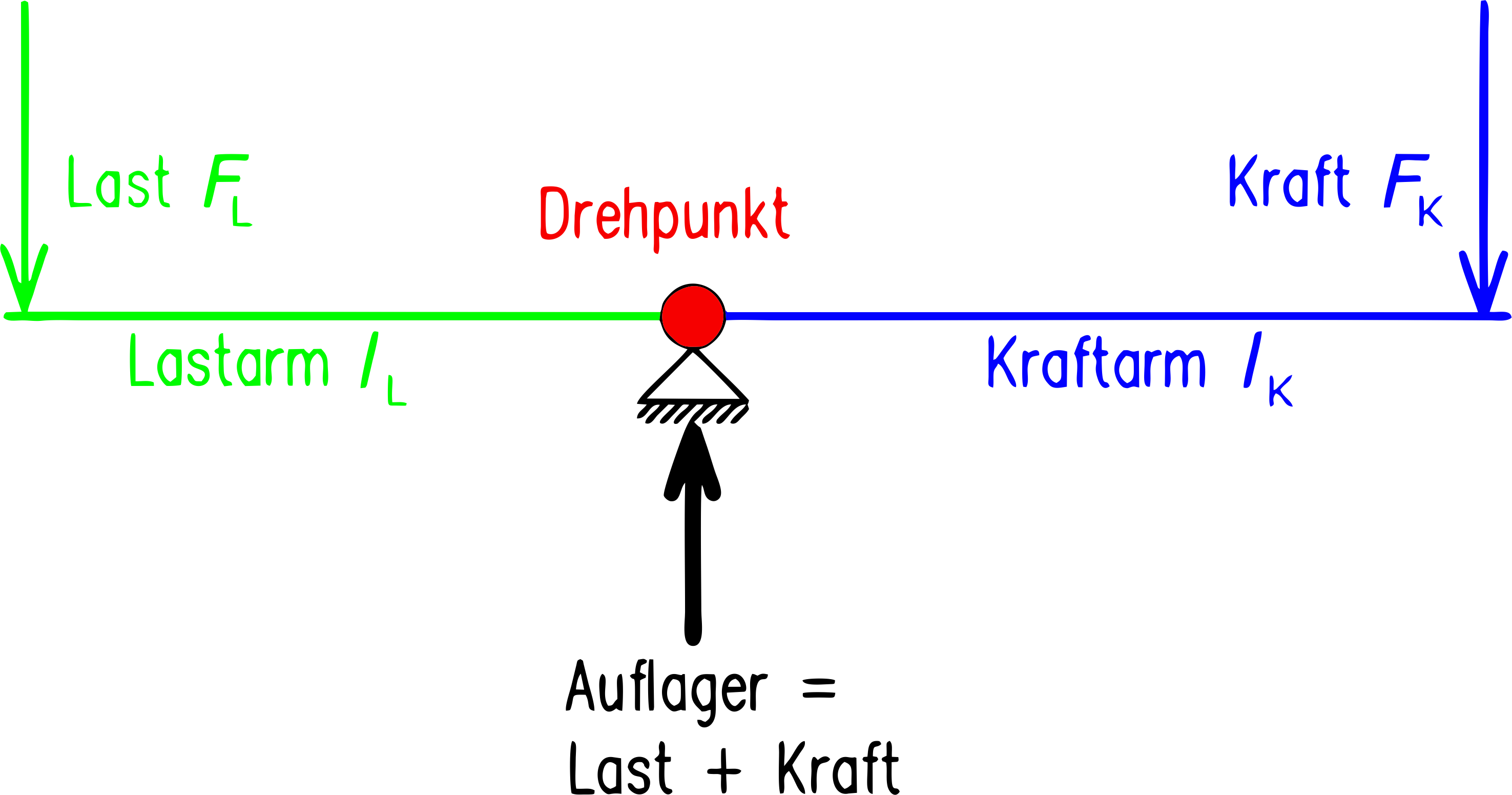Die Sturzprävention bei Menschen mit Gebrechen oder bei Älteren ist nicht ausreichend im medizinischen Fokus. Deshalb untersucht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit zwei Jahren diese Fragestellung genauer. Die Sturzprävention ist somit eine wichtige neue Priorität und dies hat sehr gute Gründe: Sie ist eine der Hauptursachen für
- Schmerzen
- Behinderungen
- Verlust der Unabhängigkeit
- Tod
Durch die Verletzungsfolgen sind Stürze die zweithäufigste Todesursache. Aber auch die Zahl der bleibenden Behinderungen ist mit 38 Millionen behinderungsbedingte Lebensjahre (disability-adjusted life years) verloren. Das Risiko für eine notwendige Langzeitpflege zu benötigen sowie Heimunterbringung ist groß. Interessant ist, dass Stürze eine soziale Komponente haben: mehr als 80 % der Betroffenen haben ein mittleres bis niedriges Einkommen{M Graça: Prevention of falls in the elderly: physical therapy strategies. Revista de Investigação & Inovação em Saúde, 2022}.
Zu den persönlichen Konsequenzen gibt es auch wichtige gesellschaftliche Folgen. Die finanziellen Kosten sind erheblich und steigen weltweit. Aktuell leben über eine Milliarde Menschen mit einem Alter von über 60. Bis zum Jahr 2030 wird sich die Zahl auf 1,4 Milliarden erhöhen und bis 2050 verdoppeln. Die Zahl der Menschen mit einem Alter von über 80 wird sich verdreifachen. Schon jetzt werden die Kosten für schwere Stürze auf 37,3 Milliarden geschätzt.
In der Praxis gibt es mittlerweile eine große Übereinstimmung der empfohlenen Maßnahmen:
Risikostratifizierung
Stratifikation ist das Abschätzen der Höhe des Risikos. Es stammt von dem lateinischen Begriff stratum für Schicht und facere für machen. Es werden also Schichten gebildet der verschiedenen Risikogruppen. Die fortschreitende Minderung wird den möglichen Folgen zugeordnet. Dies können Komplikationen, Behinderungen oder der Tod sein. Ein individuelles Risikoprofil kann so mittels mathematischer Verfahren schnell erstellt werden.
Tests
Es gibt viele Tests zur Beurteilung von Gang und Gleichgewicht. Mittels dieser können individuelle Minderungen exakt bestimmt werden. Auf dieser Basis können dann Bewegungs- und Übungsprogramme erstellt werden.
Multifaktorielle Interventionen
Multifaktorielle Maßnahmen könnten die Sturzrate im Vergleich zu Standardversorgung oder Aufmerksamkeit vermindern{Sally Hopewell, Olubusola Adedire, Bethan J Copsey, Graham J Boniface, Catherine Sherrington, Lindy Clemson, Jacqueline CT Close, Sarah E Lamb: Multifaktorielle und mehrere Komponenten umfassende Maßnahmen zur Sturzprävention für ältere, im häuslichen Umfeld lebende Menschen, Cochrane Database of Systematic Reviews Review – Intervention 23 July 2018}. Die multifaktoriellen Maßnehmen enthalten mehrere Komponenten und umfassende Maßnahmen. Sie enthalten dabei auch die üblicherweise empfohlenen Übungen, es wird aber versucht eine möglichst umfassende Unterstützung zu gewährleisten. Dies erfordert eine interdisziplinäre Arbeit.
Medikationsabstimmung
Studien zeigen, dass Medikamente mit einem hohen Sturzrisiko nicht selten verabreicht werden, obwohl hohe Sturzrisikowerte vorliegen{Jana Michalcova, Karel Vasut, Marja Airaksinen, Katarina Bielakova: Inclusion of medication-related fall risk in fall risk assessment tool in geriatric care units. BMC Geriatrics volume 20, Article number: 454 2020}.
Körperliche Bewegung
Inaktivität spielt eine Schlüsselrolle für die Sicherheit durch die neuromotorischen Mechanismen, welche für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts erforderlich sind.
Physiotherapie
In den letzten Jahrzehnten hat die Evidenz zur Spezifität physiotherapeutischer Übungen für ältere Menschen mit identifiziertem Sturzrisiko gezeigt. Es gibt deutliche und positive Auswirkungen auf das Gleichgewicht. Das vermindert eindeutig das Sturzrisiko. Dabei sind die Übungen abwechslungsreich. Es werden verschiedene motorische Zielsetzungen (Kraft, Ausdauer, Tempo, Flexibilität, Koordination) angestrebt und dabei Übungen mit gezielten Gleichgewichtsanforderungen verbunden. Die propriozeptiven Anteile zur Stärkung der Wahrnehmung nehmen einen hohen Stellenwert ein.
Einen besonderen Stellenwert erhält die Propriozeption. Der Begriff stammt aus dem lateinischen proprius für eigen und recipere für das Aufnehmen. Es bezeichnet damit die Wahrnehmung des eigenen Körpers im Raum sowie den Stellungen von Kopf, Rumpf und Gliedmaßen zueinander. In ihr werden auch die Veränderungen in der Bewegungen erfasst. Dazu zählen Empfinden für Schwere/Leichtigkeit, Spannung/Schlaffheit, Kraft/Energie, Geschmeidigkeit/Flexibilität und Geschwindigkeit/Tempo.
Umgebung, Kleidung, Hörhilfen, Sehkorrektur & Schuhwerk
Im persönlichen Umfeld müssen alle möglichen Maßnahmen ergriffen werden, welche die persönliche Sicherheit erhöhen. Angefangen von einfachen Handgriffen bis zu komplexen Sicherheitsmaßnahmen wie zum Beispiel ein Treppenlift sollen alle täglichen und nächtlichen Umgebungsbereiche zu einer hohen Sicherheit beitragen.
Alle körperlichen Unterstützungen von einer guten Sehhilfe bis zu gutem Schuhwerk sind maßgebend für die Sicherheit im Alltag. Dies gilt auch und insbesondere für die Kleidung. Sie soll die Beweglichkeit fördern und nicht behindern.
Überwachung der Osteoporose
Vornehmlich Frauen neigen zu einer Abnahme der Knochenfestigkeit im Alter. Dies muss regelmäßig überprüft werden.
Fazit
Die Sturzprophylaxe ist kein Wunderwerk. Vielen älteren und gebrechlichen Menschen könnte mit wenig Hilfe viel Unterstützung zuteil werden. Leider fehlt im praktischen Alltag der Fokus sowohl in Einrichtungen als auch beim medizinischen Fachpersonal.
Bei älteren und gebrechlichen Menschen sollte es zum Standard gehören, das Sturzrisiko zu ermitteln und mit geeigneten Maßnahmen zu schützen.